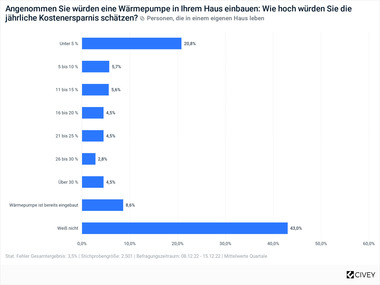Entscheidend ist der Blick auf das Gesamtsystem
Wärmepumpe für 30 Jahre altes Fertighaus
Möglichst mit „grünem Strom“ betriebene Wärmepumpen sind ein maßgeblicher Hebel, um die Wärmewende zu erreichen – weg von den fossilen Brennstoffen hin zu weitgehend regenerativen. Dass dies selbst in energetisch eher ungünstigen Bestandsobjekten möglich ist, zeigt das Beispiel eines Einfamilienhauses aus Süddeutschland. Dort wurde eine Ölheizung durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Systemair ersetzt, die ohne nennenswerte Umfeldmaßnahmen eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht.
 Das rund 30 Jahre alte Einfamilienhaus der Familie Jäger entsprach dämmungstechnisch nicht mehr heutigen Standards. Dank einer präzise abgestimmten Anlagentechnik wird das Gebäude nun ausschließlich mit einer Wärmepumpe beheizt.
Das rund 30 Jahre alte Einfamilienhaus der Familie Jäger entsprach dämmungstechnisch nicht mehr heutigen Standards. Dank einer präzise abgestimmten Anlagentechnik wird das Gebäude nun ausschließlich mit einer Wärmepumpe beheizt.
Bild: Systemair
Der Faktencheck ist eindeutig: Fast ein Drittel des Endenergieverbrauchs in Deutschland (667 TWh) geht zu Lasten der Haushalte, nahezu identisch mit dem Energiebedarf der Industrie (Umweltbundesamt, UBA; 4.2025). Entsprechend hoch waren die CO2-Emissionen; in 2024 rund 100,5 Mio. t CO2-Äquivalent. Zum Vergleich: Die komplette Industrie steht für 153 Mio. t. CO2-Äquivalent (Quelle: UBA, 03.2025). Um hierzulande die politisch bis 2045 angestrebte Klimaneutralität zu erreichen, sind also massive Anstrengungen in a) die Reduzierung des Primärenergiebedarfs generell und b) den Austausch fossiler Wärmeerzeuger zugunsten regenerativer Anlagen notwendig. Die Herausforderung: Von den 41,98 Mio. Wohnungen gehören 28 Mio. in die Baualtersklasse vor 1978, weitere 11,9 Mio. vor 2011. Die Bausubstanz liegt also energetisch betrachtet zu einem ganz beträchtlichen Anteil deutlich selbst unter den „Basis-Anforderungen“ der ersten Energieeinsparverordnung (EnEV), die am 1. Januar 2002 in Kraft trat...
 Raum ist in der kleinsten Ecke: Die kompakte Außeneinheit der „SYSHP Mini“-Wärmepumpe fand ganz dezent neben der Nebeneingangstür ihren Platz.
Raum ist in der kleinsten Ecke: Die kompakte Außeneinheit der „SYSHP Mini“-Wärmepumpe fand ganz dezent neben der Nebeneingangstür ihren Platz.
Bild: Systemair
Das hat Konsequenzen, denn der staatlich geförderte Königsweg des Heizungstauschs –der Ersatz fossiler Wärmeerzeuger durch hoch effiziente Wärmepumpen – stößt in vielen Objekten auf die bittere Realität hoher Heizlasten. „Dass man dann aufgrund der entsprechend hohen Vorlauftemperaturen für eine wassergeführte Wärmeverteilung pauschal auf eine Wärmepumpe verzichten muss, stimmt aber nicht“, sagt Systemair-Wärmepumpenspezialist Reiner Hackl: „Es kommt immer auf die Einzelfallbetrachtung an. Und da geht in der Praxis deutlich mehr, als es sich viele Handwerker vor Ort zutrauen“. Wie viel, zeigt das Beispiel eines typischen Einfamilienhauses im „Ländle“, nahe Stuttgart.
Das Objekt
Das schmucke Einfamilienhaus von Familie Jäger (Name von der Redaktion geändert) ist ein Fertighaus, Baujahr 1995, mit einer Wohnfläche von 130 m² und weiteren 120 m² Nutzfläche. Der jährliche Ölverbrauch von rund 1.700 l sowie die Leistung des ergänzenden Kaminofen entsprechen einer Heizlast von etwa 60 W/m2, bewegt sich also auf dem Niveau der Wärmeschutzverordnung 1995. Wobei Solveig Jäger aber auch sagt: „Wir haben es gerne warm und komfortabel, bevorzugen Raumtemperaturen über 22 °C.“ Zusätzliche Dämmmaßnahmen wurden an dem Gebäude nicht vorgenommen und auch die Fenster entsprechen dem Baujahr. Die Wärmeverteilung geschieht klassisch über Heizkörper mit einem Heizkreis für beide Wohngeschosse.
 Der nach dem Heizungstausch nicht mehr benötigte Kamin der alten Ölheizung wurde für die Rohrleitungsführung zu den Klimageräten im Obergeschoss genutzt.
Der nach dem Heizungstausch nicht mehr benötigte Kamin der alten Ölheizung wurde für die Rohrleitungsführung zu den Klimageräten im Obergeschoss genutzt.
Bild: Systemair
Dass diese Wärmetechnik weder zukunftsfähig noch mit dem ökologischen Bewusstsein der Hausbesitzerfamilie kompatibel war, versteht sich anhand der Kurzbeschreibung fast von selbst. Eine Alternative zu finden, war allerdings kein leichtes Unterfangen, erinnert sich Thomas Jäger: „Die von uns angesprochenen Fachhandwerker rieten generell von einer Wärmepumpe ab, wollten mit dem Verweis auf den Wärmebedarf und vor allem die ‚alte‘ Wärmeverteilung als ökologische Alternative zum Ölkessel höchstens einen Pellet-Kessel installieren.“
Das Vorurteil
Für Reiner Hackl ist dieses Szenario nicht neu: „Es hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen nur mit niedrigen Systemtemperaturen in der Wärmeverteilung zielführend funktionieren. Also idealerweise einer Flächenheizung mit einer Spreizung von 35/29 °C oder ähnlich, die in kaum einem älteren Haus zu finden ist. Das stimmt so pauschal aber nicht. Wir verschenken dadurch nur unglaublich viele Chancen, die Wärmeerzeugung in Bestandsobjekten ressourcenschonend umzurüsten“. Denn häufig, so Reiner Hackl, seien dort die Heizkörper so groß dimensioniert, dass sie problemlos auch mit niedrigeren Vorlauftemperaturen normgerecht die gewünschten Raumtemperaturen bereitstellen können: „Und sollte das in einzelnen Räumen einmal nicht passen, werden die Heizkörper mit geringem Aufwand gegen etwas größere Modelle ausgetauscht, bis eine Vorlauftemperatur von 45 bis 50 °C zur Abdeckung der Heizlast ausreicht.“
 Reiner Hackl nahm vor dem Heizungstausch sehr genau Maß, ob die bestehenden Wärmeübertragerflächen auch bei reduzierter Vorlauftemperatur für die Wärmeversorgung des Raumes ausreichten.
Reiner Hackl nahm vor dem Heizungstausch sehr genau Maß, ob die bestehenden Wärmeübertragerflächen auch bei reduzierter Vorlauftemperatur für die Wärmeversorgung des Raumes ausreichten.
Bild: Systemair
Bei Familie Jäger hat dieser gedankliche Ansatz ganz hervorragend funktioniert, kann Reiner Hackl nach knapp einem Jahr Bilanz ziehen: „Obwohl die Heizkörper hier nicht überdimensioniert waren, waren 45 °C Vorlauftemperatur für eine Raumtemperatur von durchschnittlich 20 °C ausreichend. Unterstützt durch den Kaminofen, mit dem an besonders kalten Tagen zugeheizt wurde, kommt die Systemair-Wärmepumpe ‚SYSHP Mini Split‘ mit 16 kW Leistung modulierend nach einer kompletten Heizsaison auf eine Jahresarbeitszahl von 3,0. Für ein derartiges Gebäude und das vergleichsweise hohe Komfortbedürfnis der Nutzer ein hervorragender Wert. Vor allem wenn man bedenkt, dass keine weiteren Umfeldmaßnahmen durchgeführt worden sind.“
Die Systemkonfiguration
Im Rahmen des Heizungstausches hat Reiner Hackl zunächst einmal den alten Wärmeerzeuger (Öl-Brennwert, 22 kW Leistung) mit Speicher (200 l Inhalt) durch die 16 kW-Split-Wärmepumpe von Systemair mit zugehöriger Inneneinheit (inklusive 190 l Brauchwasserspeicher) ersetzt. Hinzu kam ein 100 l-Pufferspeicher, um unter anderem zwei zusätzlich im Dachgeschoss installierte Split-Klimageräte zu versorgen. „Das ist“, freut sich Thomas Jäger, „ein willkommener Zusatzeffekt unserer jetzt deutlich nachhaltigeren Anlagentechnik. Denn wir können über die Wärmepumpe nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Und das bedeutet bei einem Gebäude wie dem unseren, dessen Dach vergleichsweise schlecht gedämmt ist, gerade in heißen Sommern einen beträchtlichen Komfortgewinn.“
Aus installationstechnischer Sicht hat der 100 l-Pufferspeicher aber primär die Funktion der hydraulischen Entkopplung des Sekundärkreises; Er funktioniert also wie eine hydraulische Weiche. So wird die Betriebssicherheit der Wärmepumpe verbessert, da immer ein hinreichender Mindestmassenstrom anliegt. Das steigert gleichzeitig die Effizienz des Gesamtsystems.
 „Einfach muss die Heizung funktionieren“, war eine Grundforderung von Hausbesitzerin Solveig Jäger – die heute das komplette Systemair-System per Fingertipp über die zugehörige App steuert.
„Einfach muss die Heizung funktionieren“, war eine Grundforderung von Hausbesitzerin Solveig Jäger – die heute das komplette Systemair-System per Fingertipp über die zugehörige App steuert.
Bild: Systemair
Die Inbetriebnahme
Reiner Hackl: „Die entscheidenden weiteren Effizienzpunkte bis zur Jahresarbeitszahl von 3.0 haben wir allerdings, über die hydraulische Entkopplung hinaus, durch die mehrwöchige Inbetriebnahmephase gewonnen.“ Im Gegensatz zur klassischen Übergabe eines neuen Gas- oder Ölheizsystems an den Kunden überwachen unsere Heizspezialisten in dieser Zeit sehr engmaschig die Wärmepumpenanlage mit allen entscheidenden Betriebsparametern. So können wir bei Bedarf ohne Zeitverlust in kontinuierlicher Abstimmung mit den Endkunden permanent per Fernparametrierung nachjustieren, bis die Wärmebereitstellung und Wärmeverteilung im Betriebsoptimum sind.“
Im Hause Jäger betraf das im Übrigen einen wesentlichen Punkt – das Heizverhalten im Allgemeinen und die durchschnittlichen Raumtemperaturen im Besonderen. Der Hintergrund: Während bei konventionellen fossilen Wärmeerzeugern Temperaturveränderungen im Raum sehr schnell über den Heizkörperthermostaten zu beeinflussen sind, bevorzugt ein Wärmepumpensystem die eher gleichmäßige Wärmeabgabe, und das möglichst auf niedrigerem Temperaturniveau. „Um möglichst effizient zu heizen, wurde beispielsweise über die Reduzierung der Vorlauftemperatur die durchschnittliche Raumtemperatur ganz langsam auf etwa 20 °C abgesenkt. Also ein bis zwei Kelvin weniger als früher, aber die minimalen ,Komforteinbußen‘ werden direkt durch eine signifikante Verbesserung bei der Jahresarbeitszahl belohnt“, weiß Reiner Hackl aus Erfahrung.
 Ein deutlicher Komfortgewinn sind die zusätzlichen Klimageräte im Obergeschoss, die ebenfalls über die Wärmepumpe versorgt werden.
Ein deutlicher Komfortgewinn sind die zusätzlichen Klimageräte im Obergeschoss, die ebenfalls über die Wärmepumpe versorgt werden.
Bild: Systemair
Bleibt zu sagen:
Mit Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde zwar mehr Technologieoffenheit zur Erfüllung der 65 %-Erneuerbare-Energien-Forderung geschaffen. Elektrische Wärmepumpen werden aber die Hauptlast der Wärmewende tragen, da ist sich die Fachwelt einig. Beispiele wie das Einfamilienhaus von Familie Jäger zeigen, dass diese Wärme-Option tatsächlich auch in Bestandsobjekten umsetzbar ist, wenn Fachhandwerker dem Systemgedanken folgen – also zum einen Wärmebereitstellung und Wärmeverteilung als Einheit betrachten. Zum anderen wird bislang noch viel zu wenig das Effizienzpotenzial ausgeschöpft, das in der Feinparametrierung dieser Systeme liegt: Jeder um ein Kelvin reduzierte Temperaturhub, den die Wärmepumpe zu leisten hat, ist aber gleichbedeutend mit 0,1 Punkten bei der Jahresarbeitszahl. Die um 5 K abgesenkte Vorlauftemperatur macht also sofort den Unterschied zwischen einer JAZ von beispielsweise 2,5 oder 3,0 aus, mit der die Wärmepumpenanlage gemäß GEG problemlos förderfähig wäre.